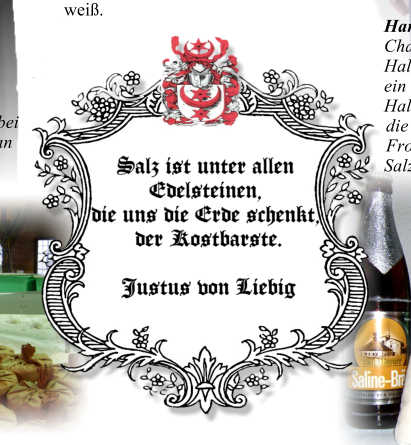1524 schlossen sich die Salzarbeiter zur „Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle“ zusammen. Man wollte damit
eine Verbesserung der sozialen Lage einfordern. Aus heutiger Sicht könnte man es die erste Gewerkschaft der Welt
nennen. Zuerst war es ein religiöser Zusammenschluss, der sich aber schnell zu einer fest organisierten Arbeits- und
Lebensgemeinschaft entwickelte. Es gab strenge Hierarchien und Regeln, aber auch Absicherungen für die Familien
bis an ihr Lebensende. Auch als 1868 das Salzsieden eingestellt wurde,
überdauerte die Brüderschaft die Jahrhunderte. Heute Tradition, fast
schon spleenig anmutend, hatten die Halloren früher besondere
Privilegien, übten sogar Macht aus. Im Bereich des Hallmarktes gab es
einst etwa 100 Siedehütten. Der Hallorenbezirk zwischen Marktkirche
und Saale schuf sich eine eigene Gerichtsbarkeit. Der Stadt Halle war
nicht erlaubt, über Halloren zu richten. Oberster Richter war der
Salzgraf. Ort der Verhandlungen war das Talamt. Noch heute erinnern
viele Straßennamen an die Salzwirkerzeit. Scheinbar seltsame Begriffe
sind nichts anderes als Bezeichnungen der Hall-
Leute. So haben wir z.B. den Hallmarkt, die
Talamtstraße, die Pfännerhöhe, die
Hackebornstraße, aber auch die
Lerchenfeldstraße. Letztere erinnert an das
Privileg des Lerchenfangs für die Tafeln der
Monarchen. Trat das „Kaltlager“ ein, musste man sich mit Nebenverdiensten über die
produktionslose Zeit helfen. So waren es die Halloren, die die Lerchen fangen
durften, aber auch fischen durften oder Leichen tragen, um die Existenz ihrer
Familien zu sichern. Übrigens begleiten auch heute noch auf Wunsch Halloren
eine Beerdigung. Allerdings muss einem der Verblichene wirklich sehr viel
wert gewesen sein. Preiswert ist so eine traditionsgeladene Beisetzung nicht.
Was heute Luxus ist; zu Zeiten von Pest und Cholera fanden sich keine
Bürger, die das Risiko einer Ansteckung eingehen wollten. So war man froh
und dankbar, dass es die Halloren gab.

Replik des Talamtes in der Moritzburg

Hallore in Trauertracht



Stand 2013



„Zum Halloren kann man sich nicht
qualifizieren. Man kann es nicht erlernen
oder käuflich erwerben. Als Hallore wird
man geboren und nur Nachfahren werden
in die Brüderschaft aufgenommen.“
So habe ich noch vor wenigen Jahren an
dieser Stelle geschrieben. Inzwischen hat
man die Regeln wegen Nachwuchsmangel
gelockert. Die Brüderschaft ist ein Verein,
dem unter bestimmten Voraussetzungen
auch „Normalsterbliche“ beitreten können.
Das Interesse muss jedoch wirklich sehr
groß sein, denn eine Aufnahme in die
Brüderschaft ist mit einer 10jährigen
Probezeit verbunden, in der genau geprüft
wird, ob der Kandidat tatsächlich würdig
ist und dieses große Privileg zu schätzen
weiß.
Steffen Kohlert ist wohl der
bekannteste Hallore. Er steht bei
den meisten Veranstaltungen an
vorderster Front und ist
Geschäftsführer des Saline-
Museums.
Hans-Ulrich Frosch ist der
Charismatischste unter den
Halloren. Der Name „Frosch“ ist
ein sehr häufiger Name bei den
Halloren. Und tatsächlich sind
die Vorfahren von Hans-Ulrich
Frosch seit vielen Generationen
Salzsieder.